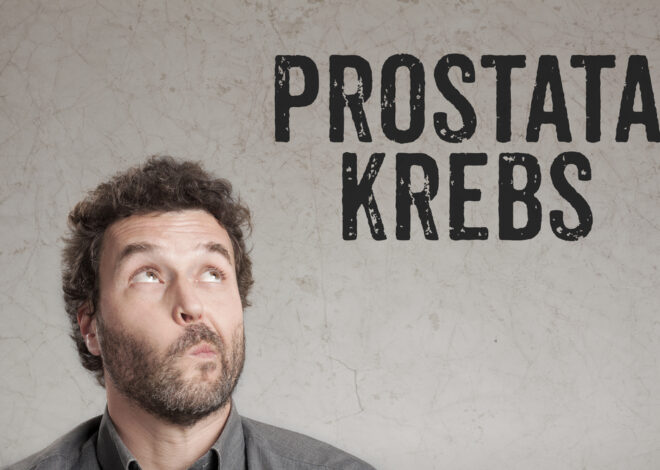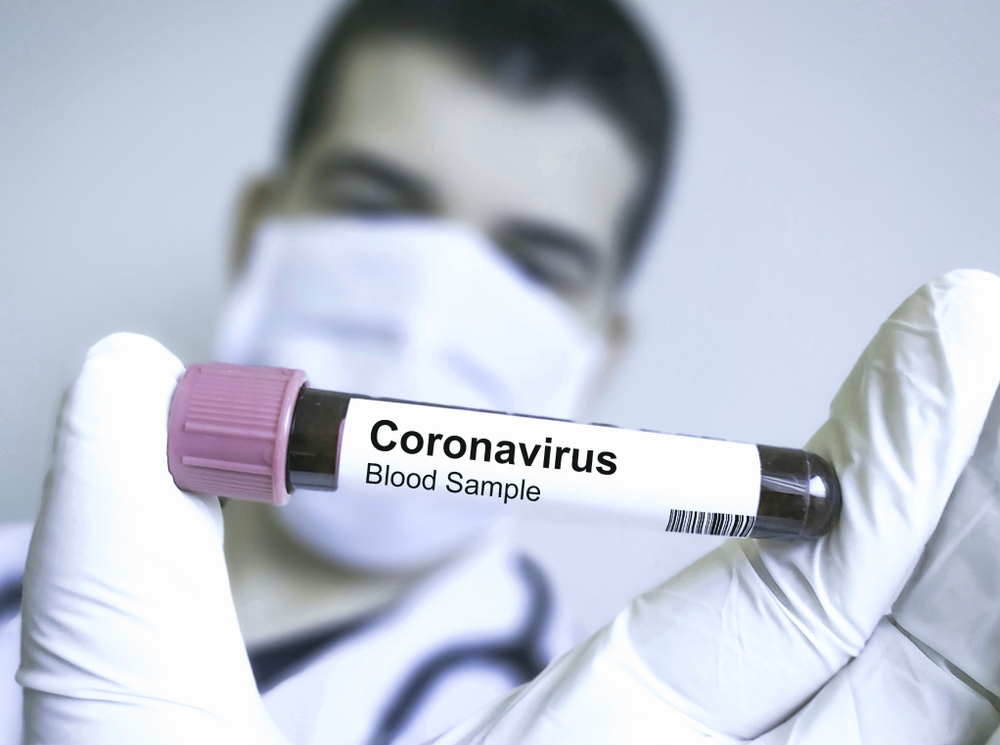Gesundheit
Je mehr Kreuzblütlergemüse, umso seltener Prostatakrebs: Neue Studie zeigt Zusammenhang
Je mehr Kreuzblütlergemüse man isst, desto seltener tritt Prostatakrebs auf. Diese Erkenntnis stammt aus einer neuen Studie, die von Forschern der Harvard T.H. Chan School of Public Health durchgeführt wurde. Die Studie ergab, dass Männer, die mindestens fünf Portionen Kreuzblütlergemüse pro Woche zu sich nehmen, ein um 25 Prozent geringeres Risiko haben, an Prostatakrebs zu […]
Wie pflanzliche Lebensmittel Ihre Gesundheit schützen: Die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung
Pflanzliche Lebensmittel sind eine wichtige Quelle für Nährstoffe und haben viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Eine Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln ist, kann das Risiko von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs senken. In diesem Artikel werden wir uns genauer ansehen, wie pflanzliche Lebensmittel Ihre Gesundheit schützen können. Pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, […]
Spirulina bei Covid-19: Potenzielle Vorteile und Wirksamkeit
Spirulina ist eine blau-grüne Alge, die bereits seit langem als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt wird. In jüngster Zeit hat sie jedoch auch Aufmerksamkeit als potentielles Mittel gegen Covid-19 erhalten. Obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass Spirulina Covid-19 heilen oder verhindern kann, haben einige Studien gezeigt, dass sie das Immunsystem stärken und Entzündungen reduzieren kann. Eine […]
Gesundheit Ernährung: Tipps für eine ausgewogene Ernährung
Gesundheit Ernährung ist ein wichtiger Aspekt des täglichen Lebens. Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, hat einen direkten Einfluss auf unsere körperliche und geistige Gesundheit. Eine ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, das Risiko von Krankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen und Fettleibigkeit zu verringern. Eine gesunde Ernährung sollte aus einer Vielzahl von Nahrungsmitteln bestehen, einschließlich […]
Wie lautet die Definition von Gesundheit? Eine klare Erklärung
Die Frage nach der Definition von Gesundheit beschäftigt viele Menschen. Es gibt unterschiedliche Ansätze und Definitionen, die je nach Kontext und Fachgebiet variieren können. In diesem Artikel soll ein Überblick über die verschiedenen Definitionen gegeben werden, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden. Eine der bekanntesten Definitionen stammt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese definiert Gesundheit […]
Opiatsucht in den USA – Droht uns in Deutschland eine ähnliche Suchtwelle?
Die Vereinigten Staaten erleben eine Drogenwelle gigantischen Ausmaßes. Primäre Verursacher sind nicht so sehr Heroin, Kokain, Crack und andere illegale harte Drogen, sondern Arzneimittel. Konkret handelt es sich um verschreibungspflichtige Schmerzmittel mit einem besonderen Wirkansatz direkt im Gehirn. Diese Gruppe von Schmerzmitteln dämpft im Gehirn Entstehung und Weiterleitung von Schmerzempfinden. Vorteil dieser Wirkweise ist die […]
Corona Virus Information zur Erkrankung
Seit Ende 2019 ist das Corona Virus ein präsentes Thema in aller Welt. Der Ursprung des neuartigen Virus liegt in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei in China. Dort wurde es zum ersten Mal bekannt. Mittlerweile ist das Corona Virus bereits in einigen Ländern Europas angekommen. Die meisten bekannten Fälle gibt es hier derzeit […]
Gesunder Food Trend – Abnehmen mit fermentierten Lebensmitteln
Fermentieren liegt momentan im Trend. Und hat viele gesundheitliche Effekte vorzuweisen. Von Fermentieren spricht man, wenn Lebensmittel wie zum Beispiel Gemüse in Salzlake eingelegt werden. Dies verleiht den Gerichten nicht nur einen besonderen Geschmack sondern macht diese auch noch länger haltbar. Diese Methode wird schon seit hunderten von Jahren verwendet um Essen vor dem Verderben […]
Verstopfte Ohren – Was tun? Tipps wie man Ohren richtig reinigen sollte
Es juckt, es nässt und es riecht unangenehm – die Rede ist hier von Cerumen, besser im Volksmund als Ohrenschmalz bekannt. Ohrenschmalz ist trotz des Ekels, welchen viele Menschen beim Anblick von Cerumen empfinden, für das Ohr ein wichtiger Schutz. Durch das gelbe bis bräunliche Fett wird das Ohr von Staubpartikeln und Schmutz gereinigt sowie […]
Was ist Schnarchen?
Schnarchen ist das heisere oder harsche Geräusch, das entsteht, wenn die Luft an entspannten Geweben in Ihrem Hals vorbeiströmt und das Gewebe beim Atmen in Schwingungen versetzt. Fast jeder schnarcht hin und wieder, aber für manche Menschen kann es ein chronisches Problem sein. Manchmal kann es auch ein Hinweis auf einen ernsthaften Gesundheitszustand sein. Darüber […]