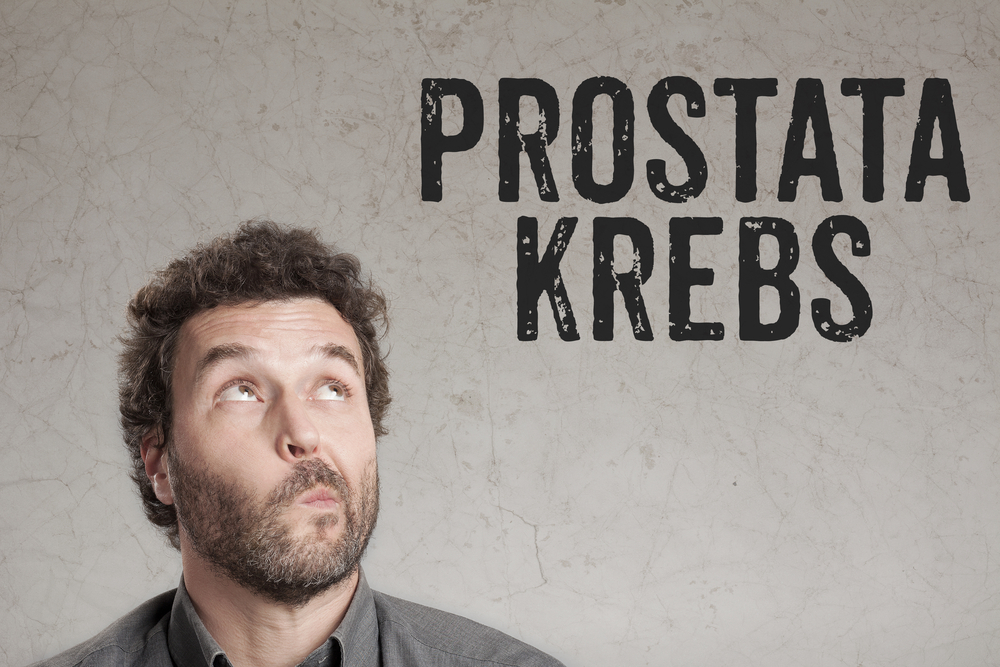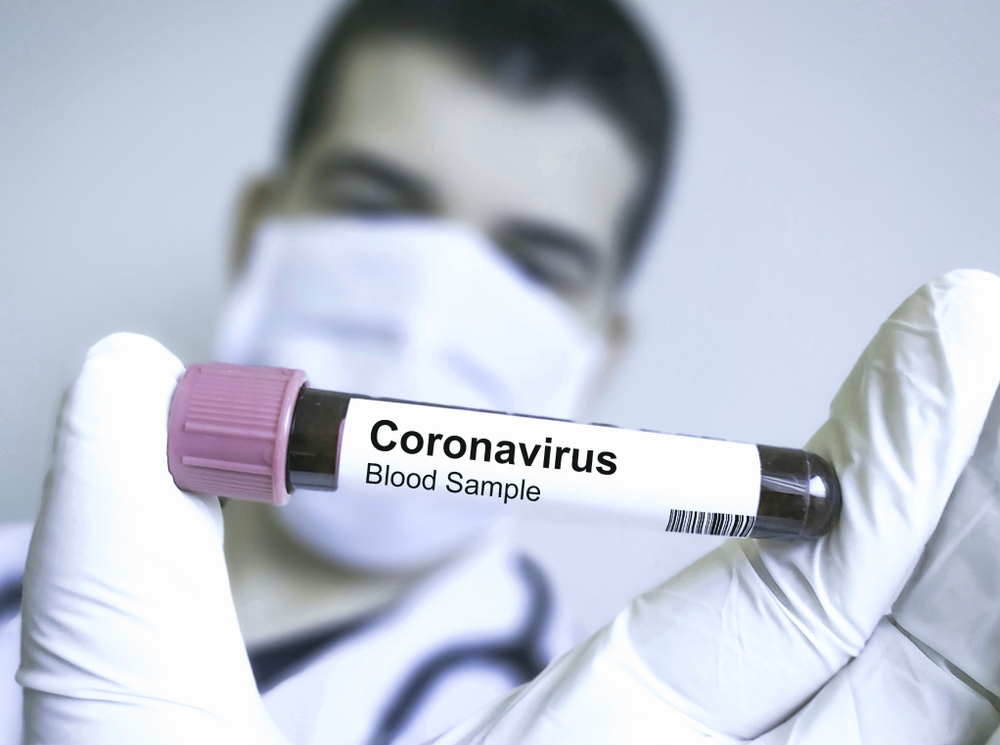Vergleiche und Reviews verstehen – wie hilfreich sind sie in Zeiten von KI?
Authentische Reviews sind im Hinblick auf immer mehr digitale Dienstleistungen und E-Commerce-Wachstum für viele Kunden von großer Bedeutung. Durch die Entwicklung generativer KIs entsteht die Gefahr, dass Erfahrungsberichte und Reviews künftig auf Knopfdruck erzeugt werden. Der Wahrheitsgehalt ist dann abhängig von der Art, wie die KI genutzt wird. Künstliche Intelligenz kann beim Verfassen von Reviews […]